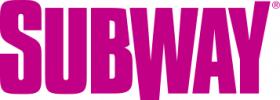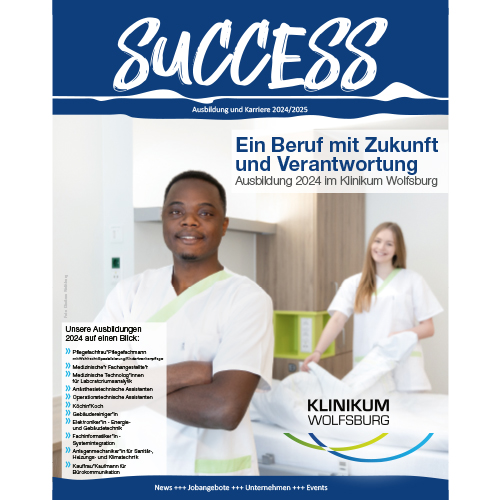Das Wintersemester steht bevor. Lohnt sich die Hoffnung auf den Campus und die WG in der Uni-Stadt?
Das neue Semester steht vor der (Haus-)Tür – denn ob es dieses Mal Präsenzveranstaltungen geben wird, steht noch in den Sternen. Endlich oder schweren Herzens die gepackten Koffer in der Hand, aus dem Elternhaus raus und ab in die chaotisch-lebhafte WG mit der improvisierten Küchenzeile und der viel zu durchgesessenen Couch. Die ersten Schritte sind getan, doch so richtig angekommen fühlt man sich noch nicht, denn etwas fehlt im Studi-Leben: die Uni.
Gespannt wie Bolle ergattert man genau zwei Minuten vor Seminarbeginn den letzten Platz im stickigen und überfüllten Hörsaal. Erst mal wird der halbdurchgeweichte Pappbecher mit dem kalten Kaffee abgestellt, um heimlich die Initiale in den abgenutzten Holztisch zu ritzen, damit dieser memorable Moment für die Nachwelt festgehalten wird. Im ersten freien Block gehts dann mit den Kommiliton:innen in die Mensa, um zu prüfen, ob das Essen wirklich so scheußlich ist, wie es in College-Filmen oft dargestellt wird. Wenige Stunden später findet man sich, die Hände auf einem leicht klebrigen, vom Bier gezeichneten Tisch, in einer Kneipe um die Ecke wieder. Die Mukke ist schlecht, aber die Stimmung unschlagbar – genauso stellen Erstis es sich vor, das wilde, unbeschwerte Uni-Leben. Die Realität sieht jedoch seit drei Semestern anders aus. Wie ist es, keinem dieser Orte, Menschen und Träume zu begegnen?
Bloß (nicht) raus aus Hotel Mama
Zu Hause ist es doch am schönsten. Dort fühlen wir uns wohl, beschützt und unbeobachtet – außer Mama platzt ohne anzuklopfen ins Zimmer. So einen Safe-Space zu finden, wenn man in eine neue Stadt zieht, ist alles andere als leicht. „Die Räume müssen sich richtig anfühlen und natürlich auch die Mitbewohner:innen, wenn man welche hat“, lacht Rene, der seit knapp drei Jahren in einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen Studenten lebt. Wir alle brauchen Rückzugsorte, an denen wir uns sicher und frei fühlen. Kleine Blasen, in denen wir für uns, aber nicht einsam sind. „Ich habe es immer genossen, mal allein zu Hause zu sein“, bestätigt Lorena, die mit drei Geschwistern aufgewachsen ist und gleichzeitig meint: „Deshalb wollte ich fürs Studium auch erst mal alleine in eine Wohnung ziehen. Den Platz und die Zeit nur für mich nutzen. Freunde treffe ich ja dann sowieso – das dachte ich zumindest. Dann kam der Lockdown.“ Seit Beginn der Pandemie sind Single-Apartments gerade für Studienanfänger:innen sehr einsame Orte und deshalb für viele keine Option mehr. Denn wofür in die Uni-Stadt ziehen, wenn man dort letztlich mit sich, dem Mini-Backofen und der Tiefkühl-Pizza gemeinsam einsam ist? Etliche suchen jetzt aufgrund der neuen Lebensumstände nach Gemeinschaft innerhalb ihres Heims, kehren zurück ins Elternhaus oder ziehen gar nicht erst aus, um den Alltag nicht allein zu beschreiten, die gleichen Sorgen zu teilen und natürlich auch Spaß zu haben. „Ohne meine Mitbewohner wären die vergangenen Monate unvorstellbar langweilig gewesen und ich wäre sicher durchgedreht“, gesteht Rene.
Campus ohne Kumpels
Wenn alles neu ist, brauchen wir einen Anhaltspunkt, an dem wir uns festhalten können. Dieser soziale Strohhalm ist für Studierende in der Regel der Universitätscampus. An diesem lebendigen Treffpunkt beginnt der große Neuanfang: Gleich am ersten Tag wird man Freunde fürs Leben finden, für die erste Hausarbeit gehts in die Bibliothek, wo man auf der Suche nach diesem einen verflixten Buch gedankenzerstreut mit der oder dem einen zusammenstößt. Reale Ernüchterung: Studierende sitzen seit über einem Jahr im Schlafanzug vor dem Computerbildschirm und verbringen die Mittagspause allein mit Netflix.
Auch wenn der Campus überfordernd sein kann, impliziert er doch eine gewisse Sicherheit und gleicht einer Oase für alle, denen es nach Kaffee oder Bier durstet. „Man findet prinzipiell immer irgendwo Gleichgesinnte, die den verdammten Raum auch nicht finden“, erinnert sich Rene zurück an seinen ersten Uni-Tag. „Ich bin sehr dankbar für mein erstes Präsenzjahr und will mir gar nicht vorstellen, wie dieser neue Lebensabschnitt zu Corona-Zeiten gewesen wäre“, offenbart der Chemie- und Biologiestudent kopfschüttelnd. Einen solchen undankbaren Corona-Einstieg musste Lorena leider erleben, die sich vor ihrem Studium sicher war: „Das Schöne am Umzug in die Uni-Stadt ist ja, dass man auf dem Campus Kommiliton:innen und neue Freunde kennenlernt. Vor Ort begegnen sich ja viele Neuankömmlinge, die auch Kontakt suchen.“ Normalerweise ist das Uni-Gelände tatsächlich ein Ort der gesellschaftlichen Begegnung. Deshalb organisieren sich eingefleischte Langzeit-Studis auch kein Mensa-Date, sondern begegnen in der Pizza- und Pasta-Schlange der Mensa sowieso immer irgendjemandem, dem auch flüssiger Mozzarella durch die Adern fließt. Wenn diese Austausch- und Begegnungs-Hot-Spots vom einen auf den anderen Tag nicht mehr zugänglich sind, verändert sich selbstredend der gesamte Uni-Vibe. „Dann ist nicht nur alles neu, sondern es bleibt auch fremd“, bedauert Lorena, die im ersten Corona-Wintersemester für ihr Soziologie-Studium von Braunschweig nach Freiburg zog. „Hätte ich gewusst, was mich erwartet, wäre ich sicher nicht ausgezogen. Zumindest hätte ich mir eine WG gesucht, um überhaupt ein paar Menschen zu begegnen – wenn auch nur im Hausflur.“
Ai, ai, ai, was sehen wir da: Noch keine Erstis an der Bar
Egal, ob Bar, Club oder Kneipe – in jeder Lebenslage haben uns während des Lockdowns Orte des Austausches gefehlt. In der grauen Einsiedler-Zeit hat sich das Leben wie pausiert angefühlt. „Eine neue Stadt kann ganz allein ein ziemlich einsamer Ort sein“, offenbart Lorena, die nach einem Semester in der fremden Stadt wieder in die Braunschweiger Heimat zurückkehrte, um das anhaltende Online-Studium in ihrem Elternhaus fortzuführen. „Ich wusste, dass ich in Freiburg nichts verpasse. Es gab ja noch keine Kneipentouren oder Picknicks im Park mit anderen Studierenden. Zu Hause bin ich erst mal nicht allein. Sobald die Präsenzlehre beginnt, werde ich in Freiburg jeden Uni-Moment aufsaugen“, erklärt die Soziologie-Studentin hoffnungsvoll.
Die Kneipe an der Ecke, das Lieblings-Restaurant oder die Bar mit dem süßen Kellner sind offene Orte, die möglichst viele Gesellschaftsgruppen einschließen und Raum für ihre Bedürfnisse bieten. Sie leben genau wie der Campus von Begegnungen und bilden die Basis für unser gesellschaftliches Beisammensein. „Meinetwegen muss ich den digitalen Seminarraum nie wieder betreten, sobald der echte wieder offen ist“, lacht Rene. Wir alle brauchen Raum für Diskussionen, Kultur, Freunde und Liebe. Die Vorfreude auf reale Begegnungen und verträumte Uni-Vorstellungen bleibt ungebrochen. Also hoffen wir auf Studis an der Bar – mit viel Glück zum Studienstart im Oktober.
Text Michelle Abdul-Malak
Foto carolmalmeida03