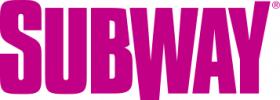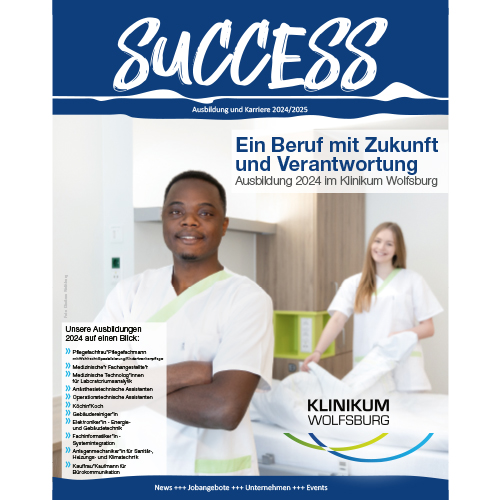Natja Brunckhorst zum Drama „Alles in bester Ordnung“
Mit „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ wurde Natja Brunckhorst im Alter von 13 Jahren über Nacht berühmt. Nach dem Schauspielstudium in Bochum spielte sie in „Tiger, Löwe, Panther“ von Dominik Graf, im Horrorthriller „Babylon“ von Ralf Huettner oder in „Der Krieger und die Kaiserin“ von Tom Tykwer. Als Drehbuchautorin schrieb sie für „Die Kommissarin“ und den „Tatort“. Für die autobiografische Liebesgeschichte „Wie Feuer und Flamme“ gab es den Deutschen Filmpreis. Nun präsentiert Natja Brunckhorst mit der Komödie „Alles in bester Ordnung“ ihr Spielfilmdebüt als Regisseurin. Corinna Harfouch spielt darin eine Frau, deren Sammelwut extreme Ausmaße annimmt.
Frau Brunckhorst, hätten Sie nicht einmal Lust auf ein Interview, in dem von „Christiane F.“ und der Begegnung mit David Bowie keine Rede ist?
Stimmt, das wäre eine Premiere! (lacht). Mir ist es allerdings ziemlich egal, ob das Thema angesprochen wird. Wenn es jedoch allein nur darüber geht, vergeht mir ein bisschen die Lust.
Dann sprechen wir über Flaschensortieranlagen, die im Film eine zentrale Rolle spielen. Kommt man auf solche Ideen, wenn man frustriert am Leergut-Automaten steht, der wieder einmal streikt?
Ich bin ein großer Fan von „Die Sendung mit der Maus“! Die Überlegung war: Der Mann hat einen technischen Beruf und der Film handelt von Ordnung. Da gerät die Flaschensortieranlage zum perfekten Objekt. Die Umsetzung der Idee war allerdings schwieriger als gedacht. Erst nach langer Suche fanden wir schließlich in Oberhausen einen Betrieb, der uns das Drehen erlaubte – wofür sogar eigens die Produktion angehalten wurde.
Was hat es mit dem Titel auf sich?
Wenn man die Wohnung zum ersten Mal sieht, wird man vielleicht anzweifeln, ob der Titel zutrifft. Mir war allerdings wichtig, dass der Film ohne Wertung auskommt. Was eine richtige Ordnung ist, bleibt jedem selbst überlassen. Jede Wohnung und jeder Mensch sind so, wie sie sind in bester Ordnung. Alles andere wäre eine Bewertung.
Beruhen die Sammelqualitäten Ihrer Filmfigur Marlen auf autobiografischen Erlebnissen?
Marlen ist eine Hommage an meine Mutter. Die war eine hochintelligente Frau, sah attraktiv aus und hatte Humor. Sie besaß allerdings viel zu viele Dinge, weil Sammeln ihre große Leidenschaft war. Für mich war Corinna Harfouch die absolut perfekte Besetzung. Ich selbst war als Kind eine große Sachensucherin auf den Spuren von Pippi Langstrumpf. Häufige Umzüge haben das allerdings geändert, da wird man schnell rationaler, was den Besitz von Dingen betrifft.

Was macht die Qualität von Corinna Harfouch aus?
Abgesehen davon, dass sie eine äußerst disziplinierte Schauspielerin ist, verfügt Corinna über eine ganz unglaubliche Präsenz. Es gibt Menschen, die stellen sich in einen Raum und strahlen diese enorme Präsenz aus. Dazu gehört Corinna auf jeden Fall. Die Kamera saugt sich regelrecht an dieser Frau fest.
Ist diese Marlen eigentlich schon ein Messie oder doch schlussendlich nur eine harmlose Sammlerin?
Marlen ist überhaupt kein Messie. Sie ist ein Mensch, der zu viele Dinge hat und sammelt. Es gibt Begriffe, die haben in sich eine Wertung. Solche Begriffe möchte ich vermeiden, weil sie nicht der Wahrheit entsprechen. Marlen ist für mich eine exzessive Sammlerin, die zugleich einen unheimlich hohen Wertanspruch an sich und an das Leben hat.
Mit der Ausstattung des Films könnte man wohl im ZDF gut 20 Jahre „Bares für Rares“ bestreiten. Wo haben Sie diese ganzen Dinge, Dekoartikel und Antiquitäten aufgetrieben?
Das sind Spenden von Freunden und Bekannten. Wir sind zudem auf Flohmärkte und in Sozialkaufhäuser gegangen. Bei der Ausstattung mussten wir wirklich ranklotzen, denn damit eine Wohnung im Film voll aussieht, muss sie total überladen sein. Unsere Szenenbildnerin Zazie Knepper hat Objekte eigens an die Decke gehängt, wodurch die Wohnung wie eine Höhle wirkt. Wir wollten den Raum ja nicht beliebig vollstellen, sondern eine ganz eigene Welt damit erschaffen.
Werden die Dreharbeiten unter solchen Verhältnissen nicht zum Geduldsspiel?
In einer realen Wohnung wären solche Dreharbeiten nicht möglich gewesen. Die Kulissen wurden in einem ehemaligen Krankenhaus aufgestellt mit Wänden, die verschiebbar waren. Dennoch war es unglaublich eng, insbesondere unser Tonmann, ein Riese von zwei Metern, musste unglaublich aufpassen, nirgendwo anzustoßen.
Solch eine Geschichte könnte schnell zum Kitsch geraten. Wie begegnen Sie solchen Klischee-Klippen?
Du musst ja mutig sein, um etwas Besonderes zu schaffen. Du schrammst immer an so einer Kante entlang und musst dich darauf verlassen, es irgendwie zu schaffen, eine besondere Note in den Film zu bekommen. Ich hätte die Geschichte ganz realistisch erzählen können, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte, dass die Zuschauer lachen können. Dass es Schauwerte zum Staunen gibt. Und dass dem Publikum das Herz aufgeht. Mein Ziel war ein Feelgood-Movie, der zum Nachdenken einlädt. Ob diese Gratwanderung funktioniert, weiß man vorher nicht. Das erfährt man nur, wenn man das Wagnis eingeht.
Zum Schluss doch noch eine Frage zu „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“: Wie lief denn nun Ihre Begegnung mit David Bowie?
David spielte damals in New York Theater. Mit dem Team flogen wir hin und haben mit ihm in einer sehr intimen Situation drehen können. Ich hätte gerne damals, als ich nach dem Dreh für ein paar anschließende Fotoaufnahmen bei David auf dem Schoß sitzen durfte, mehr über ihn, sein Werk und Talent gewusst. Aber ich war gerade 14 und hatte von Musik keine Ahnung. Wenn ich heute nochmal auf David Bowies Schoß sitzen dürfte, abgesehen davon, dass das ja leider nicht mehr geht, wäre ich sicher um einiges aufgeregter.
Interview Dieter Oßwald
Fotos Filmwelt Verleihagentur