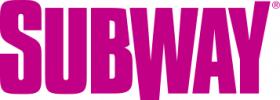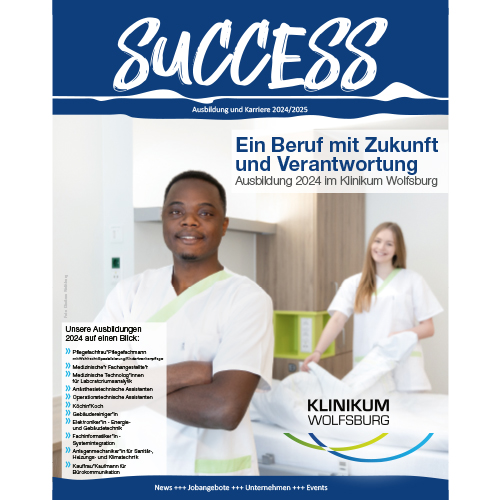Ein Film, der vom Leben handelt: Regisseur François Ozon zu seinem Familiendrama „Alles ist gut gegangen“
Er ist der Kino-Liebling der Grande Nation und Stammgast auf den wichtigen Festivals. Sein Kinodebüt „Sitcom“ durfte François Ozon ebenso wie seinen Krimi „Swimming Pool“ in Cannes präsentieren, sein Beziehungsdrama „5×2“ ging in Venedig an den Start und auf der Berlinale zeigte er die Theaterverfilmung nach Fassbinders „Tropfen auf heiße Steine“, das Lustspiel „8 Frauen“, das Kostümdrama „Angel“, das Missbrauchsdrama „Gelobt sei Gott“ und zuletzt die Fassbinder-Biografie „Peter von Kant“. Nach der fröhlichen Nostalgie-Reise „Sommer 85“ präsentiert Ozon mit „Alles ist gut gegangen“ das Drama um einen Schlaganfall-Patienten, der seine Töchter bittet, ihm beim geplanten Suizid zu helfen. Mit dem Regisseur unterhielt sich unser Filmexperte Dieter Oßwald.
Monsieur Ozon, Ihr letzter Film „Sommer 85“ wurde mit dem Kultfilm „La Boum“ verglichen. Dessen Hauptdarstellerin Sophie Marceau haben Sie diesmal engagiert. Welches Verhältnis haben Sie zum Star?
Sophie Marceau ist eine Schauspielerin meiner Generation. Mit ihr bin ich aufgewachsen und „La Boum“ war damals in Frankreich der Kultfilm schlechthin. Ich wollte Sophie schon früher in meinen Filmen dabei haben. Nach drei Absagen hat es jetzt glücklicherweise endlich geklappt. Für mich ist sie eine sehr interessante Schauspielerin, die allerdings nicht immer die Rollen bekam, die sie verdient hätte. Sophie erfindet nichts. Sie ist da, präsent, fühlt und drückt ihre Sensibilität aus.

Welche Stimmung herrscht am Set bei einem Film, in dem es um Krankheit und Tod geht? Ist das ein Dreh wie jeder andere?
Es herrschte vor allem eine Atmosphäre der Dringlichkeit. Ursprünglich wollten wir im März 2020 diesen Film drehen, der erste Lockdown kam dazwischen und wir konnten erst im Juli starten. Während dieser Zwangspause haben mich die Schauspieler fast täglich angerufen, um zu erfahren, ob das Projekt überhaupt noch zustande kommt. Als im Sommer die Krankenhäuser wieder öffneten, haben wir sofort mit dem Dreh begonnen. Am Set herrschte eine fröhliche Stimmung, weil alle froh waren, wieder arbeiten zu können – was natürlich etwas paradox war.
Welche Schwierigkeiten bringt es, die meisten Szenen in einem Krankenhaus zu drehen?
Szenen in einem Krankenhausbett erfordern eine feste Kamera mit wiederkehrenden Gegenaufnahmen. Glücklicherweise gab es mehrere Ortswechsel. Wir beginnen in einem öffentlichen Krankenhaus, wechselten dann in ein schöneres Krankenhaus und landeten schließlich in einer Privatklinik. Diese Ortswechsel ermöglichten eine Vielfalt der Bilder. Der Film hätte komplett in einem Krankenhauszimmer spielen können, aber ich wollte keinen morbiden Klinikfilm drehen.
Was halten Sie von Vergleichen mit „Liebe“ von Michael Haneke, in dem es ebenfalls um Sterbehilfe geht?
Haneke sehe ich in diesem Fall weit von mir entfernt. Mein Film handelt vom Leben. Es geht um einen Mann, der das Leben so sehr liebt, dass er sterben will. Das ist schon anders als bei Michael Haneke. Ich wollte einen Film machen, der empathisch ist und nahe bei den Figuren bleibt. Der Emotionen und Humor bietet. Der die Zuschauer betroffen macht, weil sie sich gut identifizieren können. Dafür eignet sich eine populäre Schauspielerin wie Sophie Marceau ganz besonders.
„Es geht um einen mann, der das Leben so sehr liebt, dass er sterben will“
Wie stehen Sie persönlich zur Sterbehilfe?
Vor diesem Film hatte ich dazu keine Meinung. Man muss erst mit dieser Frage konfrontiert werden, um sich mit ihr auseinanderzusetzen. Emmanuèle Bernheim, die Autorin des Romans, war eine sehr gute Freundin, bei der ich bemerkte, dass diese Situation sie traumatisierte. Es überfordert Kinder, wenn sie solch schwierige Entscheidungen für ihre Eltern treffen müssen. Es sollte per Gesetz eine Freiheit zur Selbstbestimmung geben. In Ländern, in denen Sterbehilfe erlaubt ist, gibt es schließlich keinen dramatischen Anstieg von Todesfällen. Jeder sollte das Recht haben, über den eigenen Tod zu entscheiden.
Wie groß ist die Gefahr, dass bei diesem Thema zu viel Sentimentalität oder Kitsch auftaucht?
Wir hatten als Vorlage den Roman von Emmanuèle Bernheim. Deren Stil ist sehr trocken, fast hat man das Gefühl, wie in einem Krimi mit viel Action zu sein. Da bleibt gar keine Zeit, großartig nachzudenken. Ich habe mich bei der Regie an den Vater gehalten, der einmal zu seinen Töchtern sagt, er möchte keine Heulsusen um sich haben. In dieser großbürgerlich jüdischen Familie schickte es sich einfach nicht, Gefühle zu zeigen.

Wie kam es zur Besetzung der deutschen Schauspiel-Ikone Hanna Schygulla, die in ihrer Heimat fast vergessen ist?
Mir geht es bei der Besetzung nicht um Ikonen, sondern um erstklassige Schauspieler. Ich hatte Hanna auf dem Hamburger Filmfestival kennengelernt, wo sie mir den Douglas-Sirk-Preis überreichte! Ich bewundere sie als Schauspielerin und liebte ihre Arbeit mit Fassbinder. Sie bot an, die Rolle mit einem schweizerdeutschen Akzent zu spielen. Aber mir war lieber, dass sie auf Französisch mit ihrem weichen deutschen Akzent spricht, so kennen wir sie schließlich in Frankreich.
Schygulla trat in 20 Filmen von Fassbinder auf. Sie haben ihm mit Ihrem Werk „Peter von Kant“ eine Hommage gewidmet. Welche drei Dinge begeistern Sie an Fassbinder besonders?
Zum einen ist es die Vitalität, die Energie und der Mut zum Filmemachen sowie dieses absolute Bedürfnis, Geschichten zu erzählen. Als Zweites begeistert mich, wie Fassbinder immer wieder mit derselben Truppe gearbeitet hat, die dann ständig in anderen Rollen zu erleben waren. Zum Dritten imponiert mir diese fast wütende Klarheit, mit der Fassbinder das Nachkriegsdeutschland gezeigt hat. Und wie radikal er diese deutsche Gesellschaft porträtiert hat.
Fotos Carole Bethuel Mandarin Production Foz