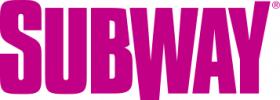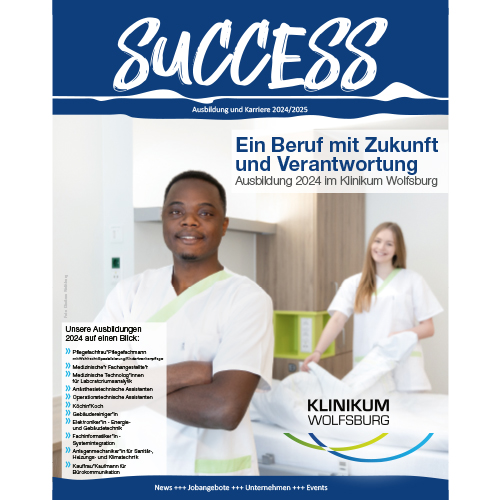Erfolgsregisseurin Doris Dörrie zur Culture-Clash-Komödie „Freibad“
Mit „Männer“ gelang Doris Dörrie anno 1985 der Durchbruch. Danach avancierte sie mit cleveren Komödien wie „Ich und er“, „Keiner liebt mich“ oder „Nackt“ zum verlässlichen Liebling bei Publikum und Presse. Ihr Drama „Kirschblüten – Hanami“ verzauberte die Berlinale. Nun gibt Doris Dörrie die Bademeisterin im gesellschaftlichen Mikrokosmos. In ihrem „Freibad“, zu dem Männer keinen Zutritt haben, steigen mit den Temperaturen die Konflikte unter den Besucher-innen. Vorurteile, Rassismus, Eitelkeiten, Schönheitsideale sind Themen dieser vergnüglichen Culture-Clash-Komödie jenseits der ausgelutschten Genre-Wege. Mit erfrischender Leichtigkeit verbindet sich da vordergründiger Klamauk mit hintersinniger Nachdenklichkeit. Burka-Verbot? Body-Shaming? Altersängste? Da gehts ganz schön ans Eingemachte. Mit der Regisseurin unterhielt sich unser Filmexperte Dieter Oßwald.

Frau Dörrie, welche Erinnerungen haben Sie an Besuche im Freibad?
Ich habe glückliche Kindheitserinnerungen an Chlorgeruch, Pommes rot-weiß und Arschbomben und dann ab der Pubertät das ständige Gefühl, beobachtet und bewertet zu werden und mit einem Mal ganz schüchtern zu sein. Ich weiß noch, dass ich mich mal einen ganzen Tag lang nicht auf den Rücken gedreht habe, weil ich mich nicht im Bikini zeigen wollte, und mir dabei einen grässlichen Sonnenbrand in den Kniekehlen geholt habe.
Worum geht es Ihnen als Bademeisterin auf dem Regiestuhl mit diesem Film?
Ich verstehe das Freibad als Metapher für Demokratie, wo wir miteinander neue Regeln aushandeln müssen. Es geht nicht, dass die alt eingestampften Gruppen sagen: Wir waren zuerst hier und bestimmen deshalb für immer und ewig, wo es langgeht. Die gesellschaftliche Realität hat sich verändert. Deswegen müssen wir miteinander reden und neugierig aufeinander sein. Wir müssen gemeinsam ein neues Miteinander aushandeln und alte Privilegien radikal hinterfragen.
Das gilt nicht nur für die Einheimischen, sondern ebenso für die Zuwandernden …
Die Privilegien nehmen die Einheimischen weiterhin für sich in Anspruch. Wir sollten nicht den Fehler begehen, anzunehmen, dass es immer „die anderen“ sind, die Probleme machen. Wir sind hier zusammen und wir alle handeln gemeinsam die neuen Regeln aus. Das ist ein sehr mühsamer Prozess, der auch wirklich kompliziert ist. Aber er ist notwendig. Für uns alle. Vor Kurzem las ich, dass acht von zehn Menschen auf der Welt nicht mehr in einer Demokratie leben. Das finde ich erschütternd. Umso mehr müssen wir uns darum kümmern, gerechte Teilhabe gemeinsam zu gestalten.

Zur Verhandlungsmasse im „Freibad“ gehört die Verschleierung. Wie halten Sie es mit dem Burka-Verbot?
Wenn Frauen über sich selbst bestimmen dürfen, dann dürfen sie doch auch anziehen, was sie wollen! Leider ist diese Voraussetzung nicht überall gegeben, ganz im Gegenteil. Weibliche Selbstbestimmung ist überall auf der Welt dünn gesät. Afghanistan erlebt wieder die Burka-Pflicht, das ist schrecklich. Jedes öffentliche Leben ist Frauen dort wieder genommen. In den USA sollen Schwangerschaftsabbrüche wieder verboten werden wie auch in manchen Ländern in Europa. Es sind keine rosigen Zeiten für Frauen, überhaupt nicht!
Es geht nicht nur um Vorurteile und Rassismus, sondern auch um Schönheitsideale und Body-Shaming. Ist das Ihre späte Rache, früher wegen des Aussehens bewertet worden zu sein?
Jede Frau erinnert sich daran, wegen ihres Aussehens bewertet worden zu sein! Und wenn wir nicht von anderen bewertet werden, bewerten wir uns selbst. Jede kennt das Gefühl, nicht schön genug zu sein. Nicht dünn genug, jung genug, nicht dies und das genug zu sein. Da hilft nur Humor und das Bewusstsein, dass wir alle so ein tiefes Ungenügen mit uns herumschleppen. Wenn man sich das bewusst macht, werden wir vielleicht sofort ein bisschen gnädiger miteinander – und auch mit uns selbst.
Bieten solche eher schwere Themen den Stoff, aus dem Komödien sind?
Wir kommen nur ins Gespräch, wenn wir miteinander lachen! Wir sehen ja, was passiert, wenn wir nicht lachen. Wenn wir aufhören zu lachen, wird alles schnell aggressiv, bis hin zu kleinsten Fragen. Humor bedeutet, ein Fenster aufzumachen und Luft reinzulassen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir uns ständig nur belehren und Recht haben wollen. Das führt zu Verhärtung und Dogmatisierung und das kann nicht das Ziel sein, denn das führt zu immer weiteren Verletzungen.

Wie groß ist die Gefahr, mit Ihrer satirischen Leichtigkeit missverstanden zu werden?
Ach, das werden vielleicht manche missverstehen, weil sie es missverstehen wollen. Aber der Film darf auch ruhig Fragen aufwerfen. Mein Plädoyer lautet, nicht einfach Dinge anzunehmen, zu bewerten, ein Urteil zu haben, sondern genauer hinzuschauen, nachzufragen, sich selbst nach den eigenen Vorurteilen zu befragen – und dann wird es schnell kompliziert. Vielfalt ist immer kompliziert, oft auch anstrengend – aber sie macht mehr Spaß und ist das Gegenteil von Dogmatismus.
Man nannte Sie die „Glücksbeauftragte“ des deutschen Films. Sind Sie auf eine gewisse Art auch die „Erziehungsbeauftragte“?
Ich mag keine didaktischen Filme. Ich möchte im Kino unterhalten werden, über den Kopf oder das Herz oder am besten über beides. Die Themen, die mich beschäftigen, möchte ich natürlich erzählen, aber eben nicht als Thesenkino. Selbst bei „Männer“ gab es für mich ein politisches Thema: die schleichende Korruption der Hippies durch den Kapitalismus. Und das habe ich versucht, so komisch wie möglich zu erzählen. Bei „Freibad“ war es eine große Lust, so viele verschiedene virulente Themen komisch zu verpacken.
 Weshalb war es wichtig, dass drei Frauen das Drehbuch zum „Freibad“ geschrieben haben?
Weshalb war es wichtig, dass drei Frauen das Drehbuch zum „Freibad“ geschrieben haben?
Ich wollte mir nicht anmaßen, authentisch über türkische Familien oder junge Frauen zu schreiben, sondern wollte multiperspektivisch erzählen. Also habe ich mir zwei Koautorinnen dazugeholt, Madeleine Fricke und Karin Kaci, die sich in diesen Bereichen sehr viel besser auskennen als ich.
Was hat es mit den Dialekten auf sich, die im Film von unterschiedlichen Figuren gesprochen werden? Der schwäbelnde Polizist, der Bademeister, der berlinert …
Es gibt Schwäbisch, Berlinerisch, Bayrisch, Fränkisch bis hin zum Schwyzerdütsch. Diese unterschiedlichen Dialekte sind für mich ein kleines, hübsches Beispiel für Vielfalt.
Ihre Titel sind stets etwas Besonderes. Wie lange braucht es zur Idee?
Ich finde das Wort sehr schön, weil man im Freibad unter der Einhaltung von ein paar Regeln ziemlich frei ist. Das ist eine gute Metapher für Demokratie.
Fotos Constantin Film